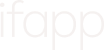Unsere Methoden

Wir arbeiten auf Grundlage und mit Methoden der Positiven Psychologie, daher hat unser Institut auch seinen Namen. Außerdem liegen in unserem methodischen Werkzeugkasten Techniken aus dem NLP (Neurolinguistisches Programmieren), der Ansatz „The Work“ von Byron Katie, systemische Strukturaufstellungen und weiteres. Alle Methoden, die wir anwenden, haben auch uns selbst persönlich inspiriert und bereichert.
Glück hängt nur zu einem geringen Anteil vom Zufall ab. Aktuelle Forschungsergebnisse aus der Positiven Psychologie belegen, dass Glück vor allem das Ergebnis von individuellen Entscheidungen ist. Glück resultiert aus einem Prozess, den wir beeinflussen können:
- durch unsere Lebensführung
- durch ein Bewusstsein für das Besondere in scheinbar kleinen Momente im Leben
- durch Fokussieren unserer Gedanken auf das, was in unserem Leben gerade gelingt
Ein solches Denken und Handeln können wir trainieren, so dass es durch Wiederholungen uns irgendwann zur Gewohnheiten wird.
Das heißt: Alle können Glück lernen. Auch du!
So arbeiten wir mit unseren Methoden
Positive Psychologie
Die Positive Psychologie ist der Zweig der Psychologie, der sich mit dem guten Leben beschäftigt. Mit dem, was gelingt und was glücklich macht.
Die klassische Psychologie hat sich lange Zeit nur auf psychologische Störungen und Krankheiten konzentriert. Die Positive Psychologie hingegen hat eine ressourcenorientierte Sichtweise auf den Menschen. Genau das wenden wir an, wenn wir in unseren Ausbildungen, Coachings, Workshops und Seminaren Menschen bei Veränderungen unterstützen.
Den Begriff Positive Psychologie hat der humanistische Psychologe Abraham Maslow 1954 erstmals verwendet. Seitdem hat sich eine eigene Forschungsrichtung etabliert. Seit den 1990er Jahren wurde die Positive Psychologie maßgeblich durch den US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman geprägt und vorangebracht.
Seligman hat fünf relevante Faktoren gefunden, die zu einem glücklichen Leben beitragen. Seine Erkenntnisse sind als „PERMA-Modell“ bekannt. Das Wort bildet sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe für die Faktoren: Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment.
All das spiegelt sich auch im Motto des ifapp wider: Glück ist mehr als Zufall. Wenn du wissen willst, was uns unser Motto bedeutet wie und unsere Arbeit am ifapp beeinflusst, lies gern den Blogartikel dazu.
NLP
Die Abkürzung NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Richard Bandler, einer der NLP-Entwickler, hat das Modell so beschrieben: „NLP is a user manual to your brain“. Also: NLP ist eine Bedienungsanleitung für dein Gehirn.
Das NLP-Modell enthält eine Vielzahl an Methoden, um die Struktur des Denkens zu verstehen und neue Lösungen für bekannte Probleme zu finden. Basis des NLP-Modells ist außerdem eine besondere innere Haltung, eine spezielle Perspektive auf die Welt.
Diese Methoden helfen uns, in Coachings schnell zu dem zu kommen, um das es eigentlich geht. In Trainings nutzen wir die Erkenntnisse aus dem NLP, um Lerninhalte besonders kurzweilig und passend für verschiedene Lerntypen zu vermitteln.
Mehr dazu liest du in unserem Blogartikel “Was ist NLP?“
The Work of Byron Katie
The Work ist eine Methode, die Ende der 1980er Jahre von der US-Amerikanerin Byron Katie entwickelt wurde. Es ist eine einfache und gleichzeitig radikale Methode, stressvolle Überzeugungen zu entdecken und zu untersuchen. Mithilfe von The Work können wir uns noch einmal in Situationen hineinversetzen, die wir als belastend erlebt haben, und dadurch die Situation für uns neu bewerten.
Für uns ist The Work wie Yoga für den Verstand: Wir helfen dem Verstand, sich in verschiedene Richtungen zu dehnen und werden dadurch mental flexibler, ausgeglichener und ruhiger.
Beim “Worken” untersuchen wir einen stressvollen Gedanken mit vier Fragen auf seinen Wahrheitsgehalt und auf seine Wirkung. Konsequent angewendet bewirkt The Work häufig radikale Veränderungen im eigenen Erleben und Verhalten.
Die vier Fragen der Work
- Ist das wahr?
- Kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist?
- Wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst?
- Wer wärst du ohne den Gedanken?
Anschließend wird der Gedanken umgekehrt und überprüft, ob das Gegenteil des Gedankens auch wahr sein könnte oder vielleicht sogar wahrer ist. Mehr zu The Work liest du hier.
Aktionsmethoden und Systemik
„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.” Dieses Mantra des Philosophen Ludwig Wittgenstein gilt in besonderem Maße für Veränderungsarbeit, wo viele Prozesse auf unbewusster Ebene ablaufen. Für viele Menschen ist es deswegen oft nicht möglich, ihre wichtigen Erkenntnisse in Worte zu fassen.
Wir setzen in unserer Arbeit daher auf Aktionsmethoden, um persönliche oder systemische Fragen szenisch darzustellen und zu bearbeiten. Durch Aktionsmethoden können Menschen und Teams mit Herz und Verstand spielerisch Veränderungen gestalten und neue Alternativen ausprobieren.
Dies können zum Beispiel Methoden aus dem Improvisationstheater oder dem Psychodrama sein. Über diesen Weg ist es möglich, dass Klient:innen ihre Fragen im Spiel ausdrücken. So werden abstrakte Sachverhalte konkret und Perspektiven ändern sich.
Zum Repertoire der Aktionsmethoden zählen auch Aufstellungen. Wir arbeiten dabei nach den Prinzipien der systemischen Strukturaufstellung nach Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd, die unsere Arbeit seit vielen Jahren inspirierend begleiten. Über die Aufstellungsarbeit werden Beziehungsmuster und Problemstrukturen in Familien, Teams oder anderen Gruppen sichtbar.
Es gibt Aufstellungen mit Gegenständen, beschrifteten Kärtchen oder auch mit Menschen, die für verschiedene Elemente im System stehen. Das szenisch Erlebte wird anschließend gemeinsam reflektiert und lässt sich aufgrund seiner Unmittelbarkeit sehr gut auf den Alltag übertragen.